|
|
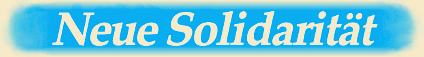
Wichtiges kurzgefaßt
Frankreichs Neustart in der Außenpolitik
Der französische Präsident Emmanuel Macron hat im August eine umfassende Neuausrichtung seiner Außenpolitik eingeleitet, die jedoch eher von Realismus als von Prinzipien getrieben ist. Die Änderung trat unmittelbar vor dem G7-Gipfel in Biarritz zutage, als er sich an seinem Sitz in Südfrankreich mit Präsident Putin traf, um einen neuen Anlauf in der Ukrainepolitik zu koordinieren, und dann während des Gipfels, auf dem er zwischen Irans Außenminister Dschawad Sarif und US-Präsident Trump zu vermitteln suchte. Macron bestätigte die Neuorientierung in seinem jährlichen Briefing an die französischen Botschafter am 27. August im Elyséepalast, wo er ankündigte, Frankreich solle in der heutigen Welt mit ihren vielen Gefahren eine „Macht des Ausgleichs“ werden, die zwischen allen Kräften vermittelt. U.a. wolle er Frankreichs Beziehungen zu Rußland stärken, da ohne diese „europäische“ Macht keine der großen Krisen zu lösen sei.
Inzwischen wurden einige dieser Versprechen erfüllt. So läuft weiterhin ein Dialog zwischen den Iranern und Trump, um das Atomabkommen (JCPOA) zu retten. Klare Fortschritte gibt es bei der Ukraine. Macron hatte als erster westlicher Staatschef den neuen Präsidenten Selenski noch vor seiner Wahl und dann nochmals im Juni empfangen. In der Anfangsphase wurden durch ihn Botschaften mit Putin ausgetauscht, die zum Durchbruch vom 7. September führten: dem Austausch von 35 Häftlingen auf beiden Seiten und Selenskis Entscheidung, sich im Donbaß sofort von zwei Orten entlang der Demarkationslinie zurückzuziehen, bevor ein allgemeiner Rückzug über die gesamte, 400 km lange Demarkationslinie stattfindet. Ein neues Gipfeltreffen im Normandie-Format (Frankreich, Deutschland, Ukraine, Rußland) soll diesen Monat in Frankreich stattfinden.
Eine der interessantesten Medienreaktionen auf diesen „Neustart“ in der Außenpolitik kam von der Rußlandspezialistin des Figaro, Isabelle Lasserre. In dem Artikel „Die Gründe, die Macrons prorussische Wende leiteten“ erinnert sie daran, daß Macron bereits als Finanzminister unter Präsident Hollande gegen die Sanktionen argumentiert hatte. Nachdem er Präsident wurde, reifte die Idee dann unter dem Einfluß seines Rußlandberaters, des Ex-Ministers Jean-Pierre Chevènement, und er änderte die Position zur Krim und spricht nur noch von einer „bloßen militärischen Geste“ Rußlands.
Laut einer vom Figaro zitierten Quelle im Elyséepalast ist Macron sehr besorgt über den „Stand der Dinge in der Welt“ und besonders den Zusammenbruch der Beziehungen zu Rußland. Die Quelle berichtet: „Die Dekonstruktion aller Mechanismen des Krisenmanagements und der multilateralen Ordnung ist zu gefährlich geworden.“ Macron habe erkannt, daß Rußland heute unverzichtbar sei, um die großen Krisen zu lösen, sei es in Syrien, Libyen, dem Iran oder der Ukraine.
Eine Rußlandspezialistin der außenpolitischen Denkfabrik IFRI nennt weitere Gründe für Frankreichs außenpolitische Offensive: Selenskis Wahlsieg, der politische Wandel in Deutschland, die Krise in Italien und das Brexit-Chaos hätten ein Machtvakuum geschaffen, das Macron füllen wolle. Auch die Schwierigkeiten im deutsch-französischen Tandem und die Unsicherheiten der Trump-Präsidentschaft trügen dazu bei. Man sollte dabei aber nicht übersehen, daß sich an der supranationalen Politik der EU nichts geändert hat.
Die Schwäche von Macrons neuer Rußlandpolitik ist, daß sein Versuch, Rußland in Europa zu „verankern“, auch darauf abzielt, Rußlands Bündnis mit China zu brechen, was Putin in Wladiwostok klar zurückgewiesen hat. Macron wird nicht mit China brechen, aber alles tun, um nicht mit beiden Mächten als Einheit zu verhandeln.
* * *
Geopolitik dämpft deutsch-chinesische Beziehungen
Während der Chinareise von Bundeskanzlerin Angela Merkel vom 5.-7. September wurden elf Kooperationsverträge in Milliardenhöhe unterzeichnet, die auf den ersten Blick beeindruckend sind. Dazu gehört ein Joint Venture zur Herstellung von Gasturbinen zwischen Siemens und der State Power Investment Corporation Limited; ein Abfallwirtschaftsprojekt in der Sonderwirtschaftszone Shenzhen zwischen der Alba Group und der Shenzhen Energy Group; ein Auftrag für das deutsche Unternehmen Streetscooter, zusammen mit der Chery Holding 100.000 E-Fahrzeuge zu bauen; und eine Kooperation zwischen Airbus und der Avic Aircraft Corporation zur Montage von Airbus 320-Maschinen in Tianjin. Hinzu kommt der schon vor Merkels Reise geschlossene Vertrag von BASF über den Bau einer großen Chemiefabrik in China für 10 Mrd. €, das größte Investitionsprojekt des Unternehmens seit Jahren.
Die positive industrielle Zusammenarbeit wird jedoch durch Deutschlands geopolitische Machenschaften in Bezug auf Hongkong überschattet. So wurde Joshua Wong, die Stimme der extremen Strömung innerhalb der Hongkonger Protestbewegung, vergangene Woche in Berlin mit Ehren empfangen, wo er auf einer Konferenz der Bild-Zeitung mit Außenminister Heiko Maas zusammentraf und weitere Kontakte zu Prominenten knüpfte. Dies löste eine scharfe Reaktion der chinesischen Regierung aus. Der deutsche Botschafter in Peking wurde vom Außenministerium vorgeladen, und der chinesische Botschafter in Berlin, Wu Ken, betonte in einer Pressekonferenz am 11. September, das Treffen mit Maas sende „sehr negative Signale“ aus und werde leider negative Auswirkungen auf die bilateralen Beziehungen haben.
Der Botschafter sagte, „äußere Kräfte“ seien an der Hongkonger Rebellion beteiligt, und warnte ausländische Politiker davor, „Gewaltverbrechen zu vertuschen und sich in die inneren Angelegenheiten Hongkongs und Chinas einzumischen... Wir haben unsere tiefe Unzufriedenheit ausgedrückt... Wong und seine Anhänger säen Gewalt.“
Gleichzeitig hat Entwicklungsminister Gerd Müller Chinas Politik in Afrika heftig angegriffen. China sei in erster Linie an den Ressourcen Afrikas interessiert, behauptete er, aber nicht daran, dort für faire Einkommen und Wertschöpfung zu sorgen. Die Chinesen brächten ihre eigenen Arbeiter mit in die Bauprojekte, für die lokale Bevölkerung würden keine Arbeitsplätze geschaffen. Solche Anschuldigungen gibt es seit Jahren, sie wurden aber längst von verschiedenen westlichen Institutionen und Denkfabriken widerlegt und von den beteiligten afrikanischen Regierungen zurückgewiesen. Müller fordert zwar seit einigen Jahren einen „Marshallplan für Afrika“, aber den Worten sind keine Taten gefolgt.