|
|
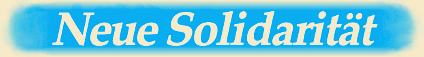
Wie man dem Westen helfen kann, die BRI besser zu verstehen
Von Helga Zepp-LaRouche
Bei Euro-Asien-Wirtschaftsforum 2019 in der chinesischen Stadt Xi’an hielt Helga Zepp-LaRouche den folgenden Vortrag. Die Zwischenüberschriften wurden von der Redaktion hinzugefügt.
Für die meisten Chinesen ist es nur sehr schwer verständlich, warum so viele Institutionen im Westen so negativ auf die BRI [Gürtel- und Straßen-Initiative] reagieren und gerade in letzter Zeit eine anti-chinesische Stimmung geschürt wird und in den USA z.B. chinesische Wissenschaftler und 450.000 Studenten unter Generalverdacht gestellt werden, Spione zu sein, was an die schlimmsten Tage der McCarthy-Ära erinnert. In Europa erheben einige Sicherheitsbehörden ähnliche Anschuldigungen. Denn die chinesische Bevölkerung erlebt die Realität der BRI aus einer völlig anderen Perspektive.
Für die Menschen in China ist die Erfahrung der letzten 40 Jahre der Reform- und Öffnungspolitik seit Deng Xiaoping eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Von einem relativ armen Entwicklungsland – ich selbst habe es 1971 erlebt, als ich zum ersten Mal in China war – hat sich China zur zweiten, in manchen Kategorien sogar bereits zur ersten Wirtschaftsnation der Welt entwickelt. 800 Millionen Menschen wurden aus der Armut befreit, es hat sich eine wohlhabende Mittelschicht von 300 Millionen und demnächst 600 Millionen mit gutem Lebensstandard entwickelt. Das Tempo der Modernisierung ist beispiellos in der Welt, wie es z.B. mit dem Ausbau eines Schnellbahnsystems von schon 30.000 Kilometern, das bald alle großen Städte miteinander verbindet, zum Ausdruck kommt.
Seit Präsident Xi Jinping im September 2013 in Kasachstan die Neue Seidenstraße auf die Tagesordnung gesetzt hat, stellt China die Kooperation mit dem chinesischen Erfolgsmodell auch allen anderen Staaten für eine Win-Win-Kooperation zur Verfügung. In den nur sechs Jahren, die seitdem vergangen sind, hat die BRI eine unglaubliche Resonanz erfahren, mehr als 130 Nationen und mehr als 30 große internationale Organisationen kooperieren mit der BRI. Das größte Infrastrukturprojekt in der Geschichte der Menschheit hat sechs große Korridore auf den Weg gebracht, Eisenbahnlinien gebaut, Häfen ausgebaut, Industrieparks und Wissenschaftsstädte gebaut, und bietet für die Entwicklungsländer zum ersten Mal die Chance auf Überwindung von Armut und Unterentwicklung.
Dabei war die BRI von Anfang an offen für alle Staaten dieser Welt. Präsident Xi Jinping hat nicht nur explizit den USA und Europa die Kooperation angeboten, sondern in unzähligen Reden auch davon gesprochen, daß er ein völlig neues Modell der internationalen Kooperation zwischen den Nationen vorschlägt, eine „shared community for the future of mankind“, eine Schicksalsgemeinschaft der einen Menschheit. Damit hat er eine in der Geschichte nie dagewesene höhere Konzeption der Zusammenarbeit vorgeschlagen, die die Geopolitik überwindet und durch ein harmonisches System der Entwicklung aller zum gegenteiligen Vorteil ersetzt. In diesem Sinne ist die BRI die absolut notwendige ökonomische Basis für eine Friedensordnung für das 21. Jahrhundert!
Während in vielen Ländern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas und selbst Europas die Neue Seidenstraße als großartige Vision begrüßt wird, als ein Konzept des Friedens durch Entwicklung, wie Papst Paul VI. es in seiner Enzyklika Populorum Progressio – „Über die Entwicklung aller Völker“ - von 1967 formuliert hatte, bezeichnen die schon genannten Institutionen dieselbe Politik Chinas als „Wettkampf der Systeme“.
Viele Chinesen verstehen nicht, wieso es zu dieser heftigen, aus geopolitischen Motiven gespeisten Reaktion kommt, und auch im Westen hat ein gewisser Gewöhnungseffekt an die Veränderungen eingesetzt, die die politische Ausrichtung und die Werteskala in den letzten beinahe 50 Jahren grundlegend geändert haben.
Der entscheidende Punkt ist der, daß im Westen seit 1971 ein Paradigmenwandel stattgefunden hat, der in die genau entgegengesetzte Richtung zu dem Weg, den China eingeschlagen hat, geführt hat.
Als Präsident Nixon am 15. August 1971 das Bretton-Woods-System und damit die festen Wechselkurse und den Goldstandard des Dollars auflöste, stellte er die Weichen für eine zunehmende Abkehr von einer an der physischen Wirtschaft orientierten Politik, hin zu einer an monetären Gewinnen der Finanzwirtschaft interessierten Politik, die zunehmend auf maximale Profitmaximierung ausgerichtet war.
Diese Tendenz wurde verstärkt durch die Aufhebung des Glass-Steagall-Trennbankensystems 1999 und die nachfolgende vollständige Deregulierung der Finanzmärkte, die zur wiederholten Blasenbildung und schließlich zu dem Bankenkrach von 2008 führte. Und da die Zentralbanken absolut nichts an den Ursachen dieses Crashs geändert haben, sondern seitdem im Gegenteil durch fortgesetztes „quantitative easing“, Nullzinsen und nun sogar negative Zinsen die Spekulation der Kasino-Wirtschaft auf Kosten der realen Wirtschaft befördert haben, steht das transatlantische Finanzsystem heute vor der Gefahr eines noch weitaus dramatischeren Krachs als vor elf Jahren.
Der amerikanische Ökonom Lyndon LaRouche, mein kürzlich verstorbener Ehemann, warnte im August 71 weitsichtig, daß eine Fortsetzung der von Nixon eingeschlagenen monetaristischen Politik zur Gefahr einer neuen Depression und eines neuen Faschismus führen würde, wenn sie nicht durch eine neue Weltwirtschaftsordnung ersetzt würde. LaRouche trat auch der malthusianisch motivierten These des Club of Rome von 1972 entgegen, daß die angeblichen „Grenzen des Wachstums“ erreicht wären – eine Irrlehre, auf der die gesamte Ökologiebewegung bis zu heutigen Zeitpunkt aufgebaut ist und die zu einer „Vergrünung“ eines großen Teils des Parteienspektrums des Westens geführt hat. LaRouche antwortete darauf mit seinem Buch Es gibt keine Grenzen des Wachstums, in dem er die Rolle der menschlichen Kreativität als Motor des wissenschaftlichen und technologischen Fortschritts als den Faktor hervorhebt, der definiert, was eine Ressource ist.
Er warnte damals auch davor, daß der mit dieser neoliberalen Wirtschaftspolitik einhergehende Wertewandel hin zu einer Drogen-Sex-Rock-Gegenkultur mittelfristig die kognitiven Fähigkeiten in der Bevölkerung zerstören und damit nicht nur eine kulturelle Krise, sondern auch die Produktivität der Wirtschaft ruinieren würde. Leider sind wir heute genau an diesem Punkt.
China geht den entgegengesetzten Weg
China schlug ab 1978 den genau gegenteiligen Weg ein. Es ersetzte die technologiefeindliche Politik der Viererbande durch eine dirigistische, durch staatliche Kreditpolitik finanzierte und auf Innovation basierende Realwirtschaft.
Was im Westen nicht verstanden wird, ist die Tatsache, daß das chinesische Wirtschaftsmodell in den Grundprinzipien mit dem Amerikanischen System identisch ist, wie es vom ersten Finanzminister der jungen amerikanischen Republik, Alexander Hamilton, mit seinem Konzept der Nationalbank und der souveränen Kreditschöpfung entwickelt worden ist. Dieses Konzept wurde vom deutschen Ökonomen Friedrich List ausgearbeitet, der in China sehr berühmt ist, es war die Basis von Lincolns Wirtschaftsberater Henry C. Carey und beeinflußte die Wirtschaftspolitik von Roosevelts Reconstruction Finance Corporation, mit der er die USA aus der Depression der 30er Jahre herausführte. Die Reconstruction Finance Corporation war auch das Vorbild der Kreditanstalt für Wiederaufbau, mit der Deutschland den Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg und das deutsche Wirtschaftswunder organisierte.
China macht also heute das, was die Basis des wirtschaftlichen Erfolges der USA und Deutschlands war, bevor sie sich von dieser Politik abgewandt und sie durch das neoliberale Modell ersetzt haben, dessen „Erfolg“ heute u.a. am Beispiel des größten Derivatehändlers der Welt – der Deutschen Bank – zu sehen ist.
Die Bedeutung der konfuzianischen Tradition
Ein extrem wichtiger Aspekt des Erfolgs der BRI, der im Westen nur unzureichend verstanden und von China meiner Auffassung nach nicht genügend herausgestellt wird, ist die kulturelle Grundausrichtung der vergangenen zweieinhalbtausendjährigen konfuzianischen Tradition der chinesischen Gesellschaft, die nur in den zehn Jahren der Kulturrevolution unterbrochen wurde. In China spielt dank dieser Tradition das Gemeinwohl eine größere Rolle als die Individualität, die im Westen seit der Renaissance eine größere Bedeutung erlangte, die sich aber mit dem liberalen Wertewandel gewissermaßen völlig verselbständigt hat und zu einem „Alles ist erlaubt“ degeneriert ist.
Die konfuzianische Tradition beinhaltet auch, daß die Entwicklung des moralischen Charakters das höchste Ziel der Erziehung darstellt, das sich in dem Begriff des „junzi“ äußert, was in etwa dem Begriff der „schönen Seele“ bei Friedrich Schiller entspricht. Es gilt deshalb in China seit mehr als 2000 Jahren als selbstverständlich, daß die Beachtung der öffentlichen Moral und die Bekämpfung schlechter Eigenschaften in der Bevölkerung die Voraussetzung für eine hochentwickelte Gesellschaft darstellt.
Im Westen geht seit der Abschaffung des Humboldtschen Erziehungsideals, dessen Mittelpunkt ebenfalls der „schöne Charakter“ war, die Vorstellung der Notwendigkeit der moralischen Verbesserung vollkommen gegen den Zeitgeist. Es ist also höchstens vom Standpunkt des aus den Fugen geratenen liberalen Systems, daß jemand China als „autoritäres System“ bezeichnen könnte, keineswegs jedoch vom Standpunkt der Kulturgeschichte Chinas.
Wer Xi Jinpings Absichten verstehen will, muß seinen Brief als Antwort auf die Anfrage von acht Professoren der Zentralen Akademie der Schönen Künste (CAFA) vor gut einem Jahr berücksichtigen, in dem er die außerordentliche Bedeutung der ästhetischen Erziehung für die geistige Entwicklung der Jugend Chinas betonte. Die ästhetische Erziehung spiele eine entscheidende Rolle in der Entwicklung eines schönen Geistes, sie erfülle die Studenten mit Liebe und fördere das Schaffen großer Kunstwerke.
Schon Konfuzius maß der Beschäftigung mit Poesie und guter Musik eine entscheidende Rolle bei der ästhetischen Erziehung des Menschen zu, aber ein absoluter Schlüssel zum Verständnis von Xi Jinpings Vision nicht nur des „Chinesischen Traums“, sondern der harmonischen Entwicklung der gesamten Menschheitsgemeinde ist der Gelehrte, der das moderne Bildungssystem geschaffen hat: der erste Erziehungsminister der provisorischen Republik China Cai Yuanpei. Cai stieß bei seinen Reisen auf der Suche nach den besten Bildungssystemen seiner Zeit schließlich in Leipzig auf die ästhetischen Schriften Baumgartens und Schillers und wurde durch die Schriften des Philosophiehistorikers Wilhelm Windelband auf das Bildungskonzept Wilhelm von Humboldts aufmerksam. Er war total begeistert über die Affinität Schillers Konzeption der Ästhetischen Erziehung mit der konfuzianischen Morallehre und erkannte, daß Schiller den Geist der deutschen Klassik mit „großer Klarheit“ prägte.
Cai nutzte diese Ideen, um das chinesische Bildungssystem zu modernisieren, und schuf für die ästhetische Erziehung den neuen Begriff meiju. Damit wurde die schon bei Konfuzius vorhandene Idee, daß die Veredlung des Charakters durch die Versenkung in die große klassische Kunst erreicht werden kann, dahingehend verstärkt, daß auf diese Weise eine Brücke geschlagen werden kann zwischen der sinnlichen Welt und der Vernunft. In einem Aufsatz vom 10. Mai 1919 formulierte Cai Gedanken, die auch für heute für die Probleme im Westen eine Brücke schlagen können:
„Ich glaube, daß die Wurzel der Probleme unseres Landes in der Kurzsichtigkeit von so vielen Leuten liegt, die schnellen Erfolg oder schnelles Geld ohne irgendeine höhere moralische Denkweise haben wollen. Die einzige Medizin ist die ästhetische Erziehung.“
Die Zukunftsgemeinschaft der Menschheit
Es fällt vielen Menschen im Westen heute schwer, zu glauben, daß es China mit seiner Idee einer Win-Win-Kooperation ernst sein könnte, weil sie sich mit dem schon beschriebenen Paradigmenwandel zu sehr daran gewöhnt haben, daß alle menschlichen Interaktionen ein Nullsummenspiel sein müssen. Aber wir sollten uns im Westen daran erinnern, daß es der Westfälische Frieden war – der 150 Jahre Religionskrieg beendete –, der das Prinzip etabliert hat, daß eine dauerhafte Friedensordnung das Interesse des anderen berücksichtigen muß. Der Westfälische Frieden begründete das internationale Völkerrecht und legte die Grundlage für die UN-Charta. Es ist der Westen, nicht China, der sich durch Konzepte wie die „Schutzverantwortung“ („R2P“), sogenannte „humanitäre“ Interventionskriege und Regimewechsel durch Farbrevolutionen, wie wir es gerade in Hongkong erleben, von den darin festgelegten Prinzipien, wie dem absoluten Respekt für die Souveränität aller Staaten, entfernt hat.
Xi Jinpings Vision von einer „Zukunftsgemeinschaft der Menschheit“ entspricht dem konfuzianischen Denken einer harmonischen Entwicklung aller, eine Tradition, zu der auch Cai Yuanpei entscheidende Gedanken beigetragen hat. Er entwarf den Traum einer „großen Gemeinschaft der ganzen Welt (datong shijie), die harmonisch und ohne Armee und Kriege gestaltet wäre, und die durch den Dialog der Kulturen erreicht werden könnte. Er verglich die Aufnahme einer Kultur durch die Kultur anderer Völker mit dem Atmen, dem Essen und Trinken des Körpers des Menschen, ohne die er nicht leben könne. Ein Blick auf die Geschichte zeige, daß jegliche Höherentwicklung der Menschheit immer durch die Auseinandersetzung mit anderen Kulturen stattgefunden habe.
Es ist bezeichnend, daß es im Westen so gut wie keine wirklichen Analysten oder auch Politiker gibt, die in einer nennenswerten Weise auf Xi Jinpings Idee einer „Schicksalsgemeinschaft für die Zukunft der Menschheit“ eingegangen sind. Wenn überhaupt, wird sie nur im Nebensatz erwähnt, so als lohne es sich nicht, darin etwas anderes als kommunistische Propaganda und eine Ansage für Chinas Absicht zu sehen, künftig eine führende Rolle auf der Weltbühne zu spielen. Aber was Xi auf dem 19. Nationalkongreß der CPC gesagt hat, war, daß die Menschen in China bis 2050, also ungefähr dem 100. Jahrestag der Gründung der PRC, Demokratie, Menschenrechte, eine entwickelte Kultur und ein glückliches Leben haben sollen. Aber eben nicht nur die Chinesen, sondern alle Völker auf diesem Planeten.
Damit ist implizit die Frage aufgeworfen – und positiv beantwortet –, die eigentlich angesichts der vielfältigen chaotischen Entwicklungen auf unserem Planeten alle Philosophen, Wissenschaftler und Staatsmänner und -frauen beschäftigen sollte: Kann sich die menschliche Gattung eine Ordnung geben, die ihr langfristiges Überleben garantiert und die der spezifischen Würde der Menschheit als kreativer Gattung angemessen ist? Xis Konzept der einen Zukunftsgemeinschaft präsentiert sehr klar die Idee, daß die Idee der einen Menschheit vorangestellt wird und erst danach und in Übereinstimmung damit die nationalen Interessen definiert werden.
Um auf dieser Ebene bei der Diskussion mithalten zu können, wie die Gestaltung dieser neuen Ordnung, die „reformierte internationale Governance“ aussehen soll, müssen wir im Westen zu genau den humanistischen Traditionen zurückkehren, die wir mit dem liberalen System beiseite geschoben haben. Korrespondierende Ideen finden wir bei Nikolaus von Kues, der eine Konkordanz des Makrokosmos nur durch eine harmonische Entwicklung aller Mikrokosmen für möglich hielt. Oder bei Gottfried Leibniz’ Idee einer prästabilisierten Harmonie des Universums, bei der eine höhere Ordnung möglich ist, weil sich mit höherer Entwicklung die Freiheitsgrade erhöhen und wir deshalb in der besten aller Welten leben. Oder der Idee von Friedrich Schiller, daß es keinen Widerspruch zwischen dem Weltbürger und dem Patrioten zu geben braucht, weil sich beide auf das Gemeinwohl der Zukunft der Menschheit orientieren.
Schlußbemerkung
China muß dem Westen helfen, das Konzept der Neuen Seidenstraße zu verstehen. China darf auf die antichinesischen Angriffe nicht defensiv reagieren, sondern sollte um so stolzer und selbstbewußter die Glanzperioden seiner eigenen Geschichte herausstellen: die Aktualität der konfuzianischen Morallehre, die schon Benjamin Franklin zu seiner eigenen Moralphilosophie inspirierte, die Besonderheiten der chinesischen Dichtkunst, die Schönheit der Literatenmalerei. Und China sollte den Westen herausfordern, selber die humanistischen Traditionen der Renaissance, von Dante, Petrarca und Brunelleschi, der Klassik in der Kultur von Bach, Beethoven und Schiller und die republikanischen Traditionen in der Politik wieder zu beleben. Nur wenn der Westen eine große „Verjüngung“ erlebt und die Ideen von Alexander Hamilton, Friedrich List und Henry C. Carey wiederbelebt, kann das Problem gelöst werden.
Leibniz war ganz begeistert von China, und er versuchte, von den Jesuitenmissionaren soviel wie möglich darüber zu erfahren. Er war fasziniert davon, daß Kaiser Kangxi zu den gleichen mathematischen Schlüssen gekommen war wie er selbst, und schloß daraus, daß es universelle Prinzipien gibt, die allen Menschen und Kulturen zugänglich sind. Er hielt die Chinesen sogar für moralisch überlegen, er schrieb:
„Jedenfalls scheint mir die Lage unserer hiesigen Verhältnisse angesichts des ins Unermeßliche wachsenden moralischen Verfalls so zu sein, daß es beinahe notwendig erscheint, daß man Missionare der Chinesen zu uns schickt, die uns Anwendung und Praxis einer natürlichen Theologie lehren könnten... Ich glaube daher: Wäre ein weiser Mann zum Schiedsrichter nicht über die Schönheit von Göttinnen, sondern über die Vortrefflichkeit von Völkern gewählt worden, würde er den goldenen Apfel den Chinesen geben...“
Der deutsche Mittelstand, die kleinen und mittleren Unternehmen und Städte wie Genua, Wien, Zürich, Lyon, Duisburg und Hamburg und viele mehr haben längst einen Begriff von dem Potential, das nicht nur im bilateralen Ausbau der Beziehungen, sondern vor allem dem Ausbau der Kooperation in Drittländern, etwa der Industrialisierung Afrikas und Südwestasiens liegt.
Der Enthusiasmus, der sich bei der internationalen Kooperation bei der Raumfahrt, der Zusammenarbeit der ESA bei den Projekten der chinesischen Weltraumbehörde, der Idee der internationalen Kooperation auf der künftigen chinesischen Raumstation, dem Bau eines internationalen Monddorfes und dem Terraforming auf dem Mars abzeichnet, unterstreicht, daß Xi Jinpings Vision einer Schicksalsgemeinschaft für die Zukunft der Menschheit in greifbare Nähe gerückt ist.