|
|
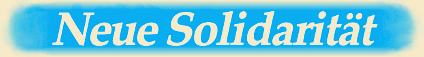
Aus Wissenschaft und Forschung
China beginnt Bau eines Hochtemperatur-Reaktors
Mitte Dezember erteilte die Nationale Reaktorsicherheitskommission die Genehmigung zum Bau eines modularen Kernkraftwerks in der Provinz Shandong. Es wird der erste kommerzielle gasgekühlte Hochtemperaturreaktor (HTGR) sein, der die in Deutschland entwickelte Kugelhaufen-Technologie verwendet. Der erste 15-MW-Versuchsreaktor dieses Typs in Deutschland wurde von 1969-88 am Kernforschungszentrum Jülich betrieben, von 1987-88 lief ein 300-MW-Demonstrationsreaktor in Hamm-Uentrop. Auch in Fort St. Vrain in Colorado/USA wurde ein ähnlicher HTGR gebaut. Die beiden Demonstrationsreaktoren wurden damals im Zuge der Anti-Atom-Hysterie nach Tschernobyl stillgelegt. Südafrika, das einzige weitere Land, das an der Kugelhaufentechnik arbeitete, beendete sein Programm 2010.
Die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten an der HTGR-Technologie in China werden an der Tsinghua-Universität in Beijing betrieben, die 20% der erwarteten Kosten von 478 Mio.$ tragen wird. Die beiden ersten, kleineren Module sollen 2016 ans Netz gehen. Zusammen werden sie 210 MW Strom erzeugen. Insgesamt sollen an diesem Standort 18 solcher Module mit einer Gesamtleistung von 3800 MW elektrischen Stroms entstehen.
Gasgekühlte Hochtemperaturreaktoren sind ein Beispiel der sog. vierten Generation der Kerntechnik, die den Strom statt mit Dampfturbinen mit Gasturbinen erzeugt, die sicherer und effizienter sind. Sie erzeugen eine höhere Betriebstemperatur, was ebenfalls die Effizienz erhöht und für Wasserentsalzung, chemische Prozesse und andere Anwendungen genutzt werden kann, die mit den heutigen, wassergekühlten Reaktoren nicht zur Verfügung stehen.
Schon 1996 hatte eine Delegation des Schiller-Instituts unter der Leitung von Helga Zepp-LaRouche den Versuchsreaktor der Tsinghua-Universität besucht.
Nach Angaben der World Nuclear News wird die SLG-Gruppe in Deutschland bis Ende nächsten Jahres 500.000 mit Graphit umhüllte Brennstoffkugeln für die Module liefern, das amerikanische Unternehmen Duke Energy wird die Mitarbeiter des Kernkraftwerks ausbilden.
Mexikanischer Wissenschaftler: Kernkraft statt Biotreibstoffe!
Biotreibstoffe seien keine Lösung für Mexikos Energieprobleme, erklärte Dr. José Ricardo Gómez Romero, ein Professor in der Abteilung für Grundlagenforschung und Ingenieurwesen am Iztapalapa-Campus der Autonomen Metropolitanen Universität Mexikos (UAM). Statt dessen empfiehlt er seinem Land, die Forschungskapazitäten auf die Kernkraft auszurichten und die Biotreibstoffe ganz aufzugeben.
Bei einer Podiumsdiskussion zum Thema „Biotreibstoffe: Lösung oder Problem?“ im Rahmen des 2. Symposiums über Nanotechnologie und Umweltqualität am Azcapotzalco-Campus der UAM wies Gómez Romero am 28. Februar darauf hin, daß Mais, Weizen, Zuckerrohr und andere Nahrungsmittel, die derzeit für die Herstellung von Biotreibstoffen verwendet werden, nicht einmal 10% des heutigen Tagesbedarfs des Landes an Brennstoffen (1,24 Mio.l) decken können - ganz zu schweigen von den Folgen, die die Verwertung von Nahrungsmitteln zur Treibstoffproduktion für Nationen wie Mexiko hätte.
Dr. Gómez Romero sagte, Mexiko würde viel besser daran tun, seine Forschungskapazitäten auf die Kernkraft als eine saubere und nachhaltige Energieform auszurichten. Leider sei deren Entwicklung in Mexiko aufgrund von Sicherheitsängsten, „die von gewisser Seite geschürt wurden“, eingestellt worden. Statt dessen würden riesige Landstriche fruchtbaren Landes der Nahrungsmittelerzeugung entzogen, was die Knappheit noch vergrößere.
Bei derselben Veranstaltung fragte der Direktor des Instituts für chemische Katalyse und Erdöl des spanischen Rats für Wissenschaftliche Forschung, nach welchen „sozialen Kriterien“ die Verwendung von Nahrungsmitteln als Treibstoff angeordnet werde, und widerlegte die Vorstellung, Biotreibstoffe seien „saubere“ Treibstoffe.
„In den nächsten 3-4 Jahren keine Möglichkeit, Asteroiden zu stoppen“
Dr. Natan Eismont, ein hochrangiger Forscher der Russischen Akademie der Wissenschaften am Forschungslabor für Weltraumforschung, -technologien, -systeme und -prozesse in Moskau, ging am 6. März in einem Interview mit ITAR-TASS über die Bedrohung durch erdnahe Asteroiden und Kometen auf verschiedene wichtige Aspekte der Problematik ein.
Auf die Frage, ob es eine internationale Zusammenarbeit gibt, um Möglichkeiten zur Beobachtung und Abwehr gefährlicher Asteroiden zu finden, sagte er: „Es gibt Gespräche und einige Bemühungen, Kontakte herzustellen, aber über diese Gespräche hinaus ist noch nichts geschehen.“
Auf die Frage, ob die Bedrohung durch Asteroiden größer werde, betonte er, daß wir das nicht wissen, weil wir nicht wissen, wie viele es von ihnen gibt und wo sie sich befinden. Optimistische Schätzungen gehen davon aus, daß bisher etwa 10% der Asteroiden, die für die Erde gefährlich werden können, identifiziert worden sind, während die Pessimisten davon ausgehen, daß nur 2% identifiziert wurden.
Auf die Frage, ob man eine Kollision eines gefährlichen Asteroiden mit der Erde verhindern könne, antwortete er rundheraus: „Nein, derzeit nicht. Ich würde sagen, daß es noch mindestens drei bis vier Jahre dauern wird, bis wir irgend etwas tun können.“
eir